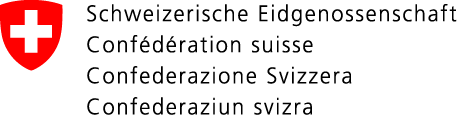Der Frauenstreik mobilisierte am 14. Juni 2019 über eine halbe Million Frauen in der ganzen Schweiz. Wo waren Sie an diesem Tag?
Wir hatten Bundesratssitzung. Ich hätte mich aber auch ohne diesen Termin nicht am Streik beteiligt. Als Mitglied der Regierung habe ich andere Mittel, Einfluss zu nehmen. Ich muss nicht an Demonstrationen teilnehmen. Dazu kommt: Obwohl ich viele der Anliegen bezüglich Gleichstellung teile, ist mir als liberaler Frau der Streikgedanke fremd.
In die TV-Kameras sagten Sie damals: "Ich glaube nicht, dass der Streik per se etwas bewegen kann." Auf den Frauenstreik folgte im Herbst jedoch die Frauenwahl. Nie zuvor zogen mehr Politikerinnen ins Parlament ein.
Der Frauenstreik hat ohne Zweifel die Sichtbarkeit der Frauen erhöht und ihre Forderungen ins Zentrum gerückt. Diese Anliegen müssen aber auch umgesetzt werden. Deshalb sagte ich, dass ein Streik per se noch nichts bewirkt. Man muss die Anliegen weitertragen, politische Prozesse initiieren, die Vorlagen müssen mehrheitsfähig sein.
Man könnte auch sagen: Sie haben die Wucht des Frauenstreiks unterschätzt.
Im linken Lager hat der Frauenstreik bei den nationalen Wahlen sicherlich eine Rolle gespielt. Bei den Bürgerlichen löste die doppelte Frauenwahl in den Bundesrat im Dezember 2018 einen Schub aus. Ich weiss von vielen Frauen, die nach dieser Wahl der FDP beigetreten sind oder den Mut gefasst haben, selber für ein politisches Amt zu kandidieren. Wenn eine grosse Partei wie meine über Jahrzehnte nur durch Männer im Bundesrat vertreten ist, schwingt da unterschwellig etwas mit. Das war wie eine offene Wunde, auch wenn man nicht darüber gesprochen hat.
Werden all diese gewählten Frauen im Parlament eine andere Politik machen?
Bloss weil mehr Frauen im Parlament sitzen, wird die Politik nicht empathischer, sozialer oder wärmer. Entscheidend sind die politischen Überzeugungen – und da ist das Spektrum von ganz linken Frauen wie Tamara Funiciello bis zur SVP-Frau Magdalena Martullo-Blocher auch innerhalb der Frauen riesig. Trotzdem: Es war überfällig, dass im Parlament endlich mehr Frauen sitzen.
Warum?
Erstens sind diese Frauen Vorbilder für andere Frauen. Und zweitens geht es auch in der Politik ums Teilen von Macht und Verantwortung. Frauen leisten viel in unserem Land, als Mütter, Erwerbstätige, in der Pflege von Angehörigen. Diese Gestaltungskraft muss sich auch in der Politik abbilden. Zur Gleichstellung gehört aber auch, dass man die politische Vielfalt unter den Frauen akzeptiert. Niemand vertritt alle Frauen.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den anderen Bundesrätinnen?
Es freut mich, dass es auch im Bundesrat eine Vertreterin der Linken, eine der Mitte und eine rechts der Mitte gibt. Wie gut man zusammenarbeitet, ist aber keine Frage des Geschlechts. Es ist eine Frage der Persönlichkeiten.
Und wie gut arbeiten diese Persönlichkeiten zusammen?
Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir diskutieren lebhaft, teils auch sehr kontrovers. Der Mythos des 4:3-Blocks, also SVP und FDP gegen den Rest, stimmt nicht. Es kommt immer wieder vor, dass zwei Bundesräte der gleichen Partei eine andere Meinung vertreten.
Die Frauen im Bundesrat zeigen aktuell mehr Gestaltungswillen als ihre männlichen Kollegen. Ein Zufall?
(zögert) Ich nehme es so wahr, dass wir drei Frauen sicherlich gestalten wollen. Was aber nicht heisst, dass dies für die Männer im Bundesrat nicht auch gilt.
Sie gelten als die führungsstärkste Person im Bundesrat.
Ich will mich nicht selbst bewerten. Im Vordergrund stehen die Sache und das Kollegium. Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten und sie geeint vertreten. Der Bundesrat muss gestalten und dem Parlament signalisieren, was er will.
Nun wurden Sie bei den Bundesratswahlen von der SVP abgestraft. Schmerzt Sie das?
Nein, ich war auch nicht überrascht. Die Parlamentarier können beim siebten und letzten Bundesratssitz Spiele machen, ohne dass sie Retourkutschen befürchten müssen. Ich bin als Bundesrätin für die Begrenzungsinitiative der SVP zuständig. Dass man mir deswegen die Stimme verweigert, habe ich zur Kenntnis genommen.
Ist es richtig, dass die Grüne Regula Rytz nicht gewählt wurde?
Es ist nicht an mir als Mitglied des Bundesrats, das zu kommentieren. Die Bundesversammlung hat entschieden, vorerst am Bestehenden festzuhalten.
Linke Frauen wie Regula Rytz haben die Deutungshoheit darüber, wie die Gleichstellung umgesetzt werden sollte. Warum bringen sich die bürgerlichen Frauen nicht aktiver ein?
Das tun sie sehr wohl – seit Jahrzehnten. Nehmen wir das Frauenstimmrecht: Das war ein überparteilicher Kampf mit vielen bürgerlichen Exponentinnen wie etwa der Wilerin Lotti Ruckstuhl.
An vorderster Front sind es aber oft Linke, die sich für Frauenanliegen starkmachen.
Das nehme ich nicht so wahr. Das Engagement bürgerlicher Frauen war immer spürbar. Mich stört zudem, dass man nur über und mit Frauen spricht: Es geht um gesellschaftspolitische Fragen, die auch die Männer betreffen. Man muss die wichtigen Anliegen mit den Männern und nicht gegen sie voranbringen. Eigentlich sollten Sie dieses Interview mit einem Bundesrat führen!
Sind Sie eine Feministin?
Als Liberale habe ich Mühe mit dem Begriff, da er von den Linken besetzt wird. Ich bin für Chancengleichheit und kämpfe dafür, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexueller Orientierung gleiche Startchancen haben. Ich akzeptiere aber Ungleichheit im Ergebnis: Menschen sind verschieden, unterschiedlich ambitioniert oder fleissig – Gleichheit kann man deshalb nicht staatlich erzwingen.
Sie sind Schirmherrin einer Allianz zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Worauf legen Sie dabei den Fokus?
Ich finde diese Allianz sehr positiv, weil sich die Wirtschaft, Politiker aller Parteien und kantonale Bildungsdirektoren engagieren. Ziel ist es, interkantonal harmonisierte Modelle für die Tagesbetreuung von Kindern zu finden. Für mich ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie der Schlüssel zu allem. Wenn Paare mit Kindern erwerbstätig bleiben wollen, sind ausserfamiliäre Betreuungsangebote sehr wichtig. Dass Frauen im Schnitt weniger verdienen und auch weniger Führungsfunktionen innehaben, liegt nicht nur, aber auch an Erwerbsunterbrüchen, mit denen sie einen jahrelangen Rückstand einfahren.
Trotzdem sind Sie gegen den Vaterschaftsurlaub oder eine Elternzeit. Dies würde den Paaren eine fairere Rollenteilung ermöglichen.
Der Bundesrat hat den Vaterschaftsurlaub abgelehnt, weil er sich auf die Vereinbarkeit fokussieren wollte. Er war der Ansicht, es sei nützlicher, die 224 Millionen Franken, die der zweiwöchige Urlaub jährlich kosten wird, in die ausserfamiliäre Kinderbetreuung zu investieren. Bei einer Elternzeit lägen die Kosten noch um ein Vielfaches höher. Es gibt ja Forderungen bis zu 38 Wochen. Doch die Vereinbarkeit muss nicht nur zu Beginn der Elternschaft, sondern über die ganze Schulzeit der Kinder hinweg gewährleistet sein.
Die beiden Elemente müssen sich ja nicht ausschliessen.
Es ist eine Illusion zu glauben, über den Vaterschaftsurlaub oder die Elternzeit könne man die Männer staatlich umpolen. Das ist eine urliberale Frage: Verändert man die Gesellschaft, indem man ihr die Veränderung gesetzlich vorgibt? Oder regelt der Staat erst, wenn ein solches Bedürfnis in der Gesellschaft gewachsen ist? Für mich ist klar: Ich will keine staatliche Erzieherin sein. Männer sind schon heute frei, sich stärker in der Familienarbeit zu engagieren.
Reden wir über Ihr erstes Amtsjahr im Justizdepartement: Wie hat Ihnen Ihre Vorgängerin Simonetta Sommaruga das EJPD hinterlassen?
Sie hat mir das Departement zu einem spannenden Zeitpunkt übergeben: Im Moment sind sicher 15 Vorlagen hängig – manche sind schon sechs Jahre alt, entsprechend kontrovers und nur knapp mehrheitsfähig. Kollege Ueli Maurer hat mir einmal gesagt, es dauere eineinhalb Jahre, bis man alles abgearbeitet habe und selber etwas Neues machen könne.
Sie haben aber durchaus bereits Akzente gesetzt: So haben Sie zum Beispiel via Begrenzungsinitiative das EU-Dossier an sich genommen. Geht so weibliche Machtpolitik?
Nein, das ist eine simple Zuständigkeitsfrage. Das EJPD ist für einen wesentlichen Teil der Europapolitik zuständig: für die Personenfreizügigkeit, aber auch für die Unionsbürgerrichtlinie und die Schengen-/Dublin-Abkommen in den Bereichen Sicherheit und Asyl. Das EJPD ist das einzige Departement, dessen Vorsteherin einen institutionalisierten Austausch mit der EU hat.
Sie sind grundsätzlich gegen Frauenquoten. Was tun Sie als Bundesrätin, um Frauen zu fördern?
Meine Vorgängerin Simonetta Sommaruga hat Geschlechterrichtwerte für grosse Unternehmen initiiert. Das Parlament hat sie im Rahmen der Aktienrechtsreform bereits gutgeheissen – was ich unabhängig von meiner persönlichen Haltung unterstützt habe, um die Gesamtvorlage nicht zu gefährden. Mir selber ist Frauenförderung sehr wichtig. Ich setze bei diesem Thema aber lieber auf die Praxis als auf die Theorie.
Zum Beispiel?
Mein Stab besteht zu 60 Prozent aus Frauen. Das ist im Vergleich mit den anderen Departementen ein sehr hoher Wert. Ich konnte sechs Positionen neu besetzen und habe vier Frauen eingestellt, darunter eine Generalsekretärin. Die meisten sind Mütter, ihnen war die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig. Da haben wir gute Regelungen gefunden. An manchen Sitzungen sind bei uns nur Frauen da. Mir ist aber Diversität grundsätzlich wichtig: Ich habe darum auch zwei Romands eingestellt.
Ihre Departementsvorgängerin setzte sich mit Vorlagen zur Lohngleichheit oder Frauenquote für die Frauen ein. Welche "Frauenthemen" liegen Ihnen am Herzen?
Für mich bleibt die häusliche Gewalt ein wichtiges Thema. Es begleitet mich, seit ich Politik mache. Als Regierungsrätin habe ich bereits 2003 dafür gesorgt, dass im Kanton St. Gallen Täter für zehn Tage von zu Hause weggewiesen werden können. Es war das erste Gesetz schweizweit, andere Kantone folgten. Das war ein wichtiges Zeichen: eine staatliche Anerkennung des Problems.
Wie setzen Sie sich nun als Bundesrätin dafür ein?
Für mich schliesst sich ein Kreis. Nächstes Jahr tritt ein Bundesgesetz in Kraft, das den Schutz gewaltbetroffener Personen verbessern will. Es geht teilweise auf eine Motion von mir als Ständerätin zurück, in der ich eine Besserstellung der Opfer im Strafverfahren verlangt habe. 90 Prozent der Verfahren bei häuslicher Gewalt werden sistiert. Und das, obwohl es sich meist um Offizialdelikte handelt! Neu ist nicht mehr das Opfer für den Entscheid verantwortlich, ob ein Verfahren fortgesetzt wird, sondern die Strafbehörde. Das entlastet das Opfer, das möglicherweise vom Täter unter Druck gesetzt wird.
Macht die Schweiz damit genug gegen häusliche Gewalt?
Ich habe einen internationalen Vergleich erstellen lassen. Er zeigt: Die Schweiz steht gut da. Neben dem Kontaktverbot und den Fussfesseln für die Täter funktioniert auch das interdisziplinäre Bedrohungsmanagement der Kantone: Schwere Gewalttaten sollen verhindert werden, indem Warnsignale frühzeitig erkannt und deeskalierende Massnahmen eingeleitet werden.
Noch immer sterben aber auch hierzulande Dutzende Frauen durch Femizide. Was läuft falsch, dass solche Taten möglich sind?
Diese Frage beschäftigt mich stark. Die Zahlen sind eindrücklich: 2018 starben 27 Personen infolge häuslicher Gewalt, 24 Frauen und drei Männer. Dazu kommen 52 versuchte Tötungen. Es ist schwierig, all diese Delikte auf einen Nenner zu bringen. Manche geschahen aus heiterem Himmel, ohne dass der Täter aktenkundig war, manche waren die Folge von Kränkungen, andere waren erweiterte Suizide. Ich habe ehrlich gesagt keine abschliessende Antwort auf Ihre Frage. Aber ich bin auch nicht bereit, das einfach so hinzunehmen.
Was muss sich denn von staatlicher Seite ändern, um die Zahl der Femizide zu verringern?
Wenn es zuvor keine Anzeichen gibt, lassen sich solche Taten kaum verhindern. Gibt es sie, ist es wichtig, früh zu deeskalieren. Polizisten sind heute gut ausgebildet und sensibilisiert. Zudem würde ich es begrüssen, wenn bei einem Kontaktverbot nicht nur der Täter, sondern auch das Opfer überwachungstechnisch ausgerüstet werden könnte.
Eine elektronische Fussfessel für die Opfer?
Nein. Die Fessel trägt natürlich nur der Täter. Das Opfer hätte eine Art Tracker, der einen Alarm auslöst, wenn sich der Gefährder annähert. Das Opfer könnte sich dann entfernen und die Polizei verständigen. Es wäre eine Alternative zur Echtzeitüberwachung, die die Kantone nicht wollen, weil sie zu ressourcenintensiv ist. In Frankreich zum Beispiel gibt es diese Möglichkeit für die Opfer bereits. Ich möchte aber auch prüfen, ob man in Vergewaltigungsstrafverfahren direkt bei den Staatsanwaltschaften eine Opferbegleitung ansiedeln könnte.
Wie wäre diese Opferbegleitung ausgestaltet?
Das Opfer hätte eine garantierte Ansprechperson, die es durch das gesamte Strafverfahren begleitet. Heute orientiert sich der ganze Prozess zu stark am Täter, am Nachweis seiner Handlungen. Das Opfer erhält zwar eine Genugtuung, fühlt sich aber im Strafverfahren vernachlässigt. Die Idee ist noch nicht ausgegoren, man müsste sie noch reifen lassen. Aber es wäre eine wertvolle Hilfe für die Opfer.
Nun soll es für Vergewaltigungen auch härtere Strafen geben.
Sie sprechen die Strafharmonisierungsvorlage des Bundesrats an. Sie ist umstritten – ich glaube nicht, dass sie in dieser Form mehrheitsfähig ist. Bei den härteren Mindeststrafen verstehe ich die Skepsis. Bei schweren Delikten gelten hohe Anforderungen an die Beweisbarkeit. Wenn die Mindeststrafe für eine Vergewaltigung von einem auf zwei Jahre heraufgesetzt wird, kann das daher die paradoxe Wirkung haben, dass es zu mehr Freisprüchen kommt. Deshalb sollten wir eine andere Lösung finden.
Amnesty International fordert, dass der Straftatbestand der Vergewaltigung neu definiert wird. Sie auch?
Ich bin offen für eine griffigere Formulierung – auch für eine geschlechtsneutrale. Nicht nur Frauen können vergewaltigt werden. Amnesty International behauptet aber, dass Vergewaltiger heute nur bestraft würden, wenn sich das Opfer aktiv gewehrt habe. Das ist nicht korrekt. Schon heute darf sich ein Mann nicht über das Nein einer Frau hinwegsetzen. Laut Bundesgericht reicht etwa der Einsatz des Körpergewichts, damit eine Nötigung vorliegt, wie sie heute für den Straftatbestand der Vergewaltigung verlangt wird. Mit 85 Prozent haben Vergewaltigungen eine relativ hohe Aufklärungsquote, das heisst, man kann den Tatverdächtigen in der Regel zumindest ermitteln. Gleichzeitig geschehen 70 Prozent dieser Straftaten in den eigenen vier Wänden. Womit wir wieder bei der schwierigen Beweisbarkeit sind. Sexualdelikte sind typischerweise Vieraugendelikte. Dieses Problem lösen wir mit einer neuen Definition nicht.
Letzte Änderung 27.12.2019