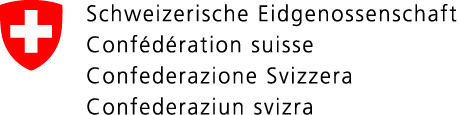Intervista, 29 agosto 2025: Bajour, Hauptstadt e Tsüri; Joël Widmer, Michelle Isler
(Questo contenuto non è disponibile in italiano.)
Die EU-Verträge, steigende Mieten in urbanen Zentren, eine elektronische ID und Massnahmen gegen Femizide: Der Stadt-Basler Bundesrat Beat Jans (SP) im grossen Interview mit Bajour, Hauptstadt und Tsüri.
Herr Jans, Sie sind der einzige Bundesrat, der in einer grossen Stadt wohnt – eigentlich in Basel, jetzt auch viel in Bern. Schwimmen Sie lieber in der Aare oder im Rhein?
Beat Jans: Ich mache beides. Der Rhein ist entspannter, die Aare aufregender. Ich möchte Ihnen aber ein bisschen widersprechen: Die anderen Bundesräte wohnen auch in Bern wie ich.
Aber Sie wohnen als einziger auch privat in einer Stadt.
Der Unterschied zu anderen Bundesräten ist, dass ich Regierungserfahrung habe in einer sehr urbanen Stadt und ich in einem ausgesprochen pulsierenden Quartier wohne, im Matthäus. Diese Erfahrungswelt gibt mir eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn im Bundesrat Themen besprochen werden, die Städte besonders betreffen.
Was sind das für Themen, bei denen man Ihnen den Städter anmerkt?
In den Städten sind gesellschaftliche Veränderungen und neue Ideen oftmals zuerst sichtbar, zum Beispiel beim Klimaschutz, da gehen die Städte voran. Diese Innovationsbereitschaft erachte ich als wichtig.
Die Städte fühlen sich aber manchmal vom Bund bei progressiven Entwicklungen gebremst. Zum Beispiel bei flächendeckendem Tempo 30 oder einer liberalen Drogenpolitik. Was können Sie als städtischer Bundesrat da bewirken?
Ich kann sehr glaubwürdig und an konkreten Beispielen aufzeigen, warum es eine schlechte Idee ist, wenn man zu fest in die kommunale oder städtische Unabhängigkeit eingreift.
Zum Beispiel?
Ich durfte als Regierungspräsident von Basel-Stadt selbst die Entwicklung eines grossen Industrieareals mitprägen.
Sie sprechen vom Klybeckareal, dessen Entwicklung eine intensive Debatte über den Anteil von gemeinnützigem Wohnraum auf solchen Arealen ausgelöst hat.
Dort habe ich realisiert, wie wichtig es ist, dass die betroffene Bevölkerung einbezogen wird und entscheidet – und nicht irgendein Gesetz aus Bern. Ich bin überzeugt, dass man den Städten die Freiheit lassen muss, ihre Ideen zu entwickeln.
Etwas anderes, von dem Sie sehr überzeugt scheinen, ist das neue EU-Vertragspaket. Sie werden auch als «EU-Turbo» bezeichnet. Gerade sind mit der US-Zollpolitik die Beziehungen zur EU im Fokus. Trotzdem gibt es immer noch viele Skeptiker*innen. Selbst die FDP ringt noch um eine Position zum Vertragspaket, das der Bundesrat im Juni präsentiert hat. Wie erklären Sie sich das?
Ich finde es richtig, dass man sich kritisch mit dieser wichtigen Vorlage auseinandersetzt. Ich bin aber der Meinung, dass das Verhandlungsresultat gut ist. Die EU hat grosse Konzessionen gemacht. Das zeichnet das Paket aus.
Zum Beispiel?
Wir konnten den Lohnschutz sichern, so dass jetzt auch die Gewerkschaften das Paket unterstützen. Im Bereich Zuwanderung haben wir die Schutzklausel erhalten. Das ist ein Zugeständnis, das kein EU-Mitgliedstaat und kein EWR-Staat hat. Und wir sind ab sofort wieder ein vollwertiges Mitglied des weltweit grössten Forschungsprogramms. Forschung, Entwicklung, Innovation – das sind letztlich die wichtigsten Ressourcen der Schweiz.
Das sind alles abstrakte Begriffe. Unsere Leser*innen wohnen mehrheitlich in urbanen Regionen. Können Sie ein Beispiel machen, was das Paket diesen Personen konkret bringt?
Viele Unternehmen, vor allem KMU, haben in den letzten Jahren stark davon profitiert, dass sie in die EU exportieren konnten und wir Teil dieses Binnenmarktes sind. Das wird bis zum Jahr 2045 pro Kopf ein zusätzliches Einkommen von 2'500 Franken generieren. Das zeigen die Studien, die wir gemacht haben.
Können Sie noch konkreter werden?
Ein ganz konkretes Beispiel: Meine Töchter wollen an Unis studieren, die ihnen grosse Perspektiven ermöglichen. Für unsere Hochschulen ist wichtig, dass sie mit den anderen Forschungsstandorten in Europa vernetzt sind. Auch unsere Jungen profitieren von einem möglichen Austausch über Grenzen hinweg: Sie können in einem anderen Land eine Lehre machen oder dort studieren. Ich habe noch ein weiteres Beispiel.
Gerne.
Wir haben während Corona gerade in den Grenzregionen auf sehr schmerzliche Art und Weise gelernt, wie wichtig es ist, dass Grenzgängerinnen und Grenzgänger weiterhin problemlos in die Schweiz kommen können. Damit sich unsere Wirtschaft entwickeln und wir unser Gesundheitswesen, unsere Baustellen betreiben können. Es geht nicht ohne Arbeitskräfte aus der EU. Dieser Teil des EU-Binnenmarktes steht natürlich je länger, je mehr zur Disposition, falls das EU-Paket abgelehnt wird und die Verträge auslaufen.
Sie betonen wirtschaftliche Vorteile der Personenfreizügigkeit. Gleichzeitig dürfte mit der Zuwanderung aus der EU die Belastung der Wirtschaftszentren in den nächsten Jahren steigen: Pendler*innenströme, Druck auf Infrastruktur wie Schulen oder Spitäler. Trägt das EU-Vertragspaket dieser Realität Rechnung?
Ja. Denn die Personenfreizügigkeit ist nicht der Treiber des Bevölkerungswachstums. Die Menschen kommen, weil wir eine erfolgreiche Wirtschaft und einen wachsenden Fachkräftemangel haben. Unsere Gesellschaft wird älter. Es gibt immer mehr Leute, die nicht mehr arbeiten. Wir brauchen die Zuwanderung, um sie zu ersetzen. Mit dem neuen Vertragspaket haben wir aber eine Schutzklausel erwirkt.
Was bringt diese?
Wenn wir durch die Zuwanderung ernsthafte soziale oder wirtschaftliche Probleme bekommen, können wir sie bremsen, ohne dass wir den bilateralen Weg aufgeben müssen. Es geht um Probleme bei der Arbeitslosigkeit, bei der Sozialhilfe oder bei zu vielen Grenzgängern. Wir entwickeln sogar Indikatoren im Bereich Verkehr und Wohnungsnot.
Kritiker*innen sagen: Wenn wir an dem Punkt sind, an dem die Schutzklausel zum Zug kommen würde, müssten wir die Zuwanderung gar nicht mehr bremsen, weil sie automatisch abnimmt.
Wenn wir das Bruttoinlandprodukt als Indikator nehmen würden, dann hätten diese Kritiker recht. Aber wir messen ja andere Schwellen, zum Beispiel die Arbeitslosigkeit oder die Sozialhilfe. Wenn dort wegen grosser Zuwanderung die Zahlen hochgehen, können wir reagieren. Das ist aber Ultima Ratio: Wir müssen also der EU klar darstellen können, dass wir ernsthafte Probleme haben und dass sie mit der Personenfreizügigkeit etwas zu tun haben.
Die SVP stellt sich vehement gegen das Vertragspaket und argumentiert mit einfachen Schlagworten: Übernahme von EU-Recht, fremde Richter, Unterwerfung. Wie wollen Sie diese Argumente entkräften?
Der Bundesrat nimmt diese Sorgen ernst und hat diese Anliegen ins Verhandlungsmandat aufgenommen. Wir haben in all diesen Bereichen Sicherungen eingebaut und sind heute besser aufgestellt als vorher. Was stimmt: Es wird eine sogenannte dynamische Rechtsübernahme geben.
Das bedeutet: In Bereichen der neuen Abkommen übernehmen wir EU-Recht, wenn sich dieses entwickelt. Im Streitfall entscheidet ein paritätisches Schiedsgericht, Parlament und Stimmvolk hätten aber ein Veto.
Wenn wir EU-Recht nicht übernehmen, obwohl die Abkommen das vorsehen, hat das Ausgleichsmassnahmen zur Folge. Wir haben aber sichergestellt, dass wir souverän und gegebenenfalls auch anders als die EU entscheiden können, ohne deswegen den bilateralen Vertrag kündigen zu müssen.
Die Schweiz müsste dann aber mit Sanktionen rechnen.
Sanktionen ist das falsche Wort. Wir erhalten mit diesem Paket Zugang zur Markthalle Europa. Da gibt es aber auch Hausregeln. Wenn wir diese nicht befolgen, sind Ausgleichsmassnahmen möglich. Dass die EU das von uns einfordert, scheint mir klar. Der Vorteil der dynamischen Rechtsübernahme ist übrigens: Unsere Firmen wissen jederzeit, dass sie das, was sie hier produzieren und exportieren wollen, in der EU auch verkaufen können.
In den Städten gibt es grundsätzlich viel Zustimmung zu den bilateralen Verträgen. Aber der Druck der Zuwanderung ist spürbar. In Zürich sind die steigenden Mietpreise ein Megathema. Braucht es im Bereich Wohnungsbau nationale Konzepte? Muss man das Thema stärker fokussieren, damit die Städte zuwanderungspositiv bleiben?
Zuwanderung gehört zur Identität der Städte. Seit jeher ziehen sie Menschen an – aus dem In- und Ausland. Dadurch haben sie jene Innovationskraft, die sie zum wirtschaftlichen Motor der Schweiz machen. Ich hoffe sehr, dass die Städte zuwanderungspositiv bleiben.
Tsüri.ch zeigt aber mit Recherchen immer wieder auf, dass der Wohnungsmarkt die Menschen sehr beschäftigt.
Die Verträge mit der EU hindern uns nicht daran, eine eigene Wohn- und Baupolitik zu gestalten. Und die Städte sind dran. In Basel werden auf Entwicklungsarealen mehr gemeinnützige und bezahlbare Wohnungen gebaut, auch von privaten Investoren. Auch der Bundesrat nimmt das Anliegen ernst.
Was tut der Bundesrat?
Wir haben Begleitmassnahmen beschlossen im Zusammenhang mit der sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative der SVP. Wir stocken zum Beispiel den Fonds zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus auf. Aber hier sind in erster Linie die Kantone und Gemeinden gefordert. Sie sind für eine durchmischte Entwicklung in den Städten und für bezahlbare Wohnungspreise verantwortlich.
Sie sind derzeit in Ihrem ersten Abstimmungskampf als Justizminister. Bis zum 28. September wollen Sie die Bevölkerung von der Einführung der E-ID überzeugen. Wofür würden Sie persönlich diese elektronische Identität als Erstes einsetzen?
Ich würde damit das Bankkonto meiner Tochter, das noch auf meinen Namen läuft, an sie übertragen. Sie wurde kürzlich volljährig. Nun müssen wir uns gleichzeitig bei der Bank ausweisen. Und da sie in Basel und ich unter der Woche in Bern wohne, ist das ziemlich schwierig zu koordinieren. Mit der E-ID wäre das sehr viel einfacher.
Welchen Nutzen hat die E-ID sonst noch für die Bürger*innen?
Wir wollen das Leben der Menschen im Internet vereinfachen – zum Beispiel bei Bestellungen von Produkten mit Alterslimite oder wenn sie Dokumente von Behörden anfordern. Es ist aber auch ein Angebot an ältere und Menschen mit einer Behinderung, die zum Beispiel Mühe haben, vor Ort bei den Einwohnerdiensten zu erscheinen. Die E-ID soll auch blinden Menschen helfen, sich im Netz auszuweisen. Der Grundsatz der Barrierefreiheit steht im Gesetz.
Sie haben die Einwohnerdienste erwähnt: Was bringt die E-ID den Städten und Gemeinden?
Mit der E-ID können Gemeinden den Menschen vereinfacht Zugang zu ihren Dienstleistungen ermöglichen, die Abläufe vereinfachen und vielleicht sogar Personal einsparen. Gleichzeitig hat man mit der elektronischen Identität die Sicherheit, dass die Leute, die sich melden, auch tatsächlich die sind, für die sie sich ausgeben.
Vor vier Jahren ist die erste Abstimmung zu einer E-ID gescheitert. Damals hätten private Firmen die ID ausstellen sollen. Warum findet jetzt auch der Bundesrat, dass der Staat dafür besser geeignet ist?
Das war die Lehre aus der Abstimmung, und das Parlament hat den entsprechenden Auftrag erteilt. Die E-ID ist staatlich und bleibt unter demokratischer Kontrolle. Sie ist in einem Gesetz geregelt. Unsere Daten kommen nicht in die Hände von privaten Firmen. Das ist ein grosser Fortschritt. Und die Applikation ist auf dem höchsten Stand der Sicherheit. Man entwickelt sie transparent im Austausch mit Interessierten aus Gesellschaft, Wirtschaft und der IT-Community und lässt sie immer wieder von ethischen Hackern herausfordern. Auch unter Computer-Nerds wird das Produkt gelobt.
Nicht von allen, denn es gibt immer noch Gegner*innen. Sie kritisieren einen Mangel beim Datenschutz. Was entgegnen Sie?
Wir haben das Datenschutzgesetz, und im EID-Gesetz ist vorgeschrieben, wer überhaupt so eine elektronische Identität verlangen darf. Und zudem haben wir eine Applikation gebaut, bei der Informationen nicht zentral, sondern nur auf dem Handy gespeichert sind.
Eine weitere Befürchtung der Gegner*innen ist, dass die E-ID nicht freiwillig bleibt, sondern zum Zwang wird.
Die E-ID ist freiwillig. Das Gesetz hält klar fest: Wer eine E-ID will, muss sie beantragen. Für ein Obligatorium müsste man zuerst das Gesetz ändern und darüber könnte das Volk wieder abstimmen.
Alle E-ID-Daten wären auf meinem Smartphone. Was mache ich, wenn mir dieses gestohlen wird?
Das läuft gleich wie mit einer Bankkarte. Wenn ich das Smartphone verliere, muss ich eine neue beantragen. Sobald mir eine neue E-ID ausgestellt wird, wird meine «alte» E-ID automatisch für ungültig erklärt.
Kommen wir zum Schluss noch zu einem aktuellen Thema. Letzte Woche hat mutmasslich ein Mann in Corcelles einen Femizid begangen. Die Zahl der Femizide in der Schweiz ist so hoch wie nie. Sie waren diesen Sommer in Spanien und haben sich dort den Umgang mit häuslicher Gewalt angeschaut. Muss der Bund hier nicht endlich handeln?
Femizide sind eine grosse Gefahr für einen erheblichen Teil unserer Bevölkerung. Die Anzahl Meldungen im Bereich der häuslichen Gewalt ist inzwischen höher als die Anzahl Verkehrsunfälle mit Verletzten. Und es gibt bei Femiziden eine starke Zunahme. Das alles ist nicht akzeptabel. Obwohl Spanien fünfmal so gross ist wie die Schweiz, hat Spanien gleich viele Femizide wie wir.
Was macht Spanien besser?
Man hat dort als Gesamtgesellschaft die schreckliche häusliche Gewalt als Problem anerkannt und ist sie mit verschiedenen Massnahmen über alle Staatsebenen entschlossen angegangen. Wir werden die spanischen Instrumente gegen häusliche Gewalt prüfen.
Welche sind das konkret?
Demnächst kommt die Botschaft zur Anpassung des Opferhilfegesetzes. Die Vernehmlassung war sehr positiv. Wenn jemand häusliche Gewalt erlebt hat, soll diese Person 24 Stunden, sieben Tage pro Woche eine professionelle Begleitung erhalten. Andererseits ist eine Beweissicherung ganz wichtig. Es soll genau dokumentiert und festgehalten werden, welche Gewalt ausgeübt worden ist. Weitere Schienen sind Schutzunterkünfte für Opfer. Darüber hinaus laufen in einigen Kantonen Pilotversuche im Bereich Electronic Monitoring, womit man potenzielle Täter besser von den Opfern fernhalten kann.
All diese Massnahmen kommen erst zum Zuge, wenn schon etwas passiert ist. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat aber auch Kampagnen angekündigt, damit betroffene Frauen und Kinder früher um Hilfe bitten, als sie es heute machen. Ist auch eine Kampagne geplant, um Buben und Männer zu sensibilisieren?
Die Präventions- und Kampagnenarbeit ist im Departement des Innern angesiedelt. Ich persönlich möchte in meiner Kommunikation und in meiner Arbeit vor allem auch Männer ansprechen. Ich sage ganz klar: Dominanz und Gewalt sind keine Zeichen der Stärke, sondern Zeichen der Schwäche. Gewalt löst nie ein Problem. Wir als Gesellschaft sind nicht bereit, Gewalt zu akzeptieren. Diese Botschaft möchte ich als Mann vor allem an Männer aussenden.
Von der Botschaft in der Innenstadt geht’s spätabends ins staatliche Nobelhotel, das hoch über der Stadt thront. Der Ausblick auf den Hafen, die Lichter der Stadt und die Hügel dahinter, dazu der Ruf des Muezzins – all das ist atemberaubend. So atemberaubend wie die Fahrten im Konvoi am nächsten Tag quer durch die Stadt mit Blaulicht und Sirenen.
Bundesrat Jans trifft am Montag den Innenminister, den Justizminister, hohe Polizeibeamte und einen Staatssekretär im Aussenministerium. Das Prozedere der Begegnungen ist immer dasselbe: Eintreffen des Konvois. Sicherheitsbeamte springen aus den Wagen, geleiten den Bundesrat eine Treppe hinauf, wo schon eine Gruppe Männer wartet. Mittendrin der Minister. Händeschütteln vor einem mächtigen, gerne von Säulen flankierten Portal. Sodann der Fototermin in einem mehr oder weniger nobel ausstaffierten Sitzungsraum: Vorne, unter einem Bild von Präsident Abdelmadjid Tebboune, der väterlich streng auf die Szenerie herabschaut, sitzen der Schweizer Bundesrat und der algerische Minister. Davor, auf langen Sofas, die beiden Delegationen in absteigender Rangfolge. Es werden Wasser, Kaffee und aromatischer, stark gezuckerter Tee gereicht.
Jans’ Gesprächspartner sind ausschliesslich Männer. In deren Begleitgruppen finden sich bloss vereinzelt Frauen, eine Übersetzerin etwa oder eine Presseverantwortliche.
Die Schweizer Delegation ist vielfältiger. Mitte-Nationalrätin Maya Bally aus dem Aargau nimmt vorne auf dem Sofa Platz, neben Eva Wildi-Cortés, der Chefin des Bundesamts für Polizei Fedpol. Hinzu kommt der Waadtländer Staatsrat Vassilis Venizelos als Vertreter der Kantone. Jans ist es ein Anliegen, mit seiner Delegation die Vielfalt der Schweiz sowie den Föderalismus abzubilden – und so die Bedeutung von Frauen in hohen Ämtern deutlich zu machen.
Fedpol-Chefin Wildi-Cortés ist es denn auch, die eine Absichtserklärung zu vertiefter Zusammenarbeit im Polizeibereich unterzeichnet. Ein entsprechendes Dokument für einen vertieften Migrationsdialog signiert später der Vizedirektor des Staatssekretariats für Migration, Hendrick Krauskopf. «Algerien ist ein Herkunfts-, Transit- und Zielland irregulärer Migration», heisst es im Communiqué des Justiz- und Polizeidepartements zu den beiden Treffen. Bundesrat Jans habe «die Herausforderungen gewürdigt», die Algerien zu bewältigen habe, und dabei auch «die Situation in der Schweiz erörtert».
Algerien hat wegen junger, krimineller Asylsuchender ein schlechtes Image in der Schweiz. Was wollen Sie mit Ihrer Reise erreichen?
Beat Jans: Die Minderheit von straffälligen Personen aus Nordafrika ist eine grosse Herausforderung für unser Asylsystem. Ich nehme die Probleme, die sich im Umfeld von Asylzentren ergeben, sowie die Vorstösse aus dem Parlament sehr ernst: Ich will schnelle Verfahren und eine schnelle Rückkehr solcher Personen. Das ist für die Akzeptanz unserer Asylpolitik wichtig.
Aber ist es überhaupt vertretbar, Menschen in ein Land wie Algerien auszuschaffen?
Es erhalten alle ein korrektes, rechtsstaatliches Verfahren. Mir ist nicht bekannt, dass Rückkehrer nach Algerien in Probleme gerieten. Sie erhalten sogar eine Starthilfe von uns. Hinzu kommt, dass rund zwei Drittel der algerischen Asylsuchenden medikamentensüchtig sind, schon bei ihrer Ausreise aus Algerien. Diesen Menschen können wir bei uns nicht helfen, sie sind in ihrer Heimat besser aufgehoben. Viele von ihnen kehren übrigens freiwillig zurück.
Welche Verbesserungen bringen denn nun die neuen Vereinbarungen?
Die Rückkehr nach Algerien läuft jetzt schon gut, wir haben zuletzt grosse Fortschritte erzielt. Für uns ist wichtig, dass es noch schneller geht, dass die algerischen Behörden ihre Bürgerinnen und Bürger noch rascher identifizieren und einreisen lassen. Wir bieten ihnen an, sie im technischen Bereich zu unterstützen, sodass Algerien auch profitieren kann.
Wir führen dieses Gespräch auf dem Flug von Algier nach Madrid. Hand aufs Herz: Für Sie als Sozialdemokrat war das Feilschen um Asylrückkehrer die Pflichtübung. In Madrid wollen Sie das erfolgreiche spanische Modell im Kampf gegen Gewalt an Frauen kennenlernen – das ist nun eine Herzensangelegenheit?
Dieses Bild gefällt mir nicht. Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Algerien bezüglich Menschenrechte und den Schutz jener Personen, die zurückgeschickt werden, wichtig ist. In Spanien geht es um Opferschutz, dass wir lernen können, wie wir die Zahl der Femizide reduzieren können. Die Anzahl getöteter Frauen, innerhalb und ausserhalb von Beziehungen, ist in der Schweiz inakzeptabel hoch. Kein Gewaltverbrechen fordert so viele Todesopfer wie die Gewalt gegen Frauen. Wir müssen alles daransetzen, solche Delikte in Zukunft zu verhindern.
Nach der Landung, noch am Montagabend, stossen die Nationalrätinnen Tamara Funiciello und Jessica Jaccoud (beide SP) zur Delegation. Später trifft sich die Gruppe mit Vertreterinnen der staatlichen Behörden, die sich im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt engagieren. Das Abendessen findet in einem traditionellen, spanischen Restaurant statt. An der Wand hängen Dutzende Bilder von Toreros, die Stiere reizen oder gerade mit dem Degen abstechen. Bloss vier Gemälde zeigen Frauen: Eine trinkt nackt Wein, die andern tanzen Flamenco. Das Ambiente ist ein Abbild des alten, spanischen Machismo.
Umso eindrücklicher ist, was die Frauen erzählen. Wie in Spanien schon vor 20 Jahren das Gesetz zum integralen Schutz gegen geschlechtsspezifische Gewalt geschaffen wurde. Ausgelöst auch durch den brutalen Mord an Ana Orantes. Die 60-Jährige hatte 1997 im Fernsehen geschildert, wie sie von ihrem Mann jahrelang verprügelt wurde. Zwei Wochen später lauerte der Mann ihr auf, übergoss sie mit Benzin und zündete sie an. Orantes starb. Der Fall sorgte landesweit für Entsetzen und Proteste.
Seither hat Spanien den Kampf gegen Femizide stetig ausgebaut. 2017 haben alle Parteien im Parlament einen Pakt verabschiedet und 1 Milliarde Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren bewilligt, um die Zahl der Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt weiter zu reduzieren. Gerade ist der Pakt erneuert worden. Im Februar 2025 haben wiederum alle Parteien 1,5 Milliarden für die nächsten fünf Jahre bewilligt, inklusive der Konservativen. Bloss die rechtspopulistische Vox sagte Nein.
Entstanden ist ein ausgeklügeltes System. Dazu gehören Prävention an Schulen und Aufklärungskampagnen, eine Notfallnummer, spezialisierte Gerichtsabteilungen und Strafverfolgungsbehörden. Zu den wichtigsten Elementen zählt ein elektronisches Monitoring, das Alarm schlägt, wenn ein Gefährder die gerichtlich verfügte Distanz zur bedrohten Frau unterschreitet. «Cometa» heisst es.
Bundesrat Jans lässt es sich am Dienstag bei einem Besuch in der Zentrale vorführen, live. Auf einem Bildschirm ist ein Stadtplan zu sehen, dazu zwei Punkte. Grün die Frau. Rot der Aggressor. Die beiden Punkte kommen sich näher. Die Operateurin greift zum Telefon, ruft zuerst die Frau an, dann die Polizei und schliesslich den Täter. Sie macht sie auf die Annäherung aufmerksam. Ob die Polizei einschreitet, entscheidet diese selbst.
Das spanische System kann nicht alle Femizide verhindern, aber es wirkt. Das zeigen die Zahlen.
In Spanien sind dieses Jahr bisher 22 Frauen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt getötet worden. In der Schweiz fast gleich viele. In Spanien leben aber fünfmal mehr Menschen. Warum ist in der Schweiz das Risiko für Frauen fünfmal höher als in Spanien, durch häusliche Gewalt ums Leben zu kommen?
Beat Jans: In Spanien hat man die Mittel gefunden, Frauen besser zu schützen. Ich sehe keinen anderen Grund. Mir zeigt das, dass auch wir in der Schweiz mit guten Gesetzen und technologischen Mitteln etwas bewirken können. Wenn ich sehe, wie stark die Zahlen bei uns ansteigen, müssen wir jetzt unbedingt vorwärtsmachen.
Spanien hat die ersten Gesetze schon vor 20 Jahren erlassen. Wie erklären Sie diesen Rückstand?
Spanien ist auch anderen Ländern weit voraus. Ich glaube auch nicht, dass unser föderalistisches System hier bremsend wirkt. Ich bin jedenfalls entschlossen, jetzt zusammen mit den Kantonen Lösungen zu finden. Ich konnte in Spanien einiges lernen.
Was genau?
Man muss das Problem global erfassen, auch statistisch. Der Begriff der häuslichen Gewalt hat teilweise den Eindruck erweckt, es handle sich um ein privates Problem. Das ist es nicht, im Gegenteil: Geschlechterbedingte Gewalt, die Femizide, sind derzeit eines der grössten Risiken, wenn es um den Schutz unserer Bevölkerung vor Verbrechen geht.
Wie wollen Sie vorgehen?
Wir müssen zuerst jene Massnahmen umsetzen, die rasch wirken. Mit der für den Herbst geplanten Revision des Opferhilfegesetzes sollen betroffene Personen sofort Zugang erhalten zu Fachpersonen in Spitälern, um Beweise zu sichern. Das erleichtert ihnen, sich zu wehren und, wenn sie das wollen, gerichtlich gegen die Täter vorzugehen. Darüber hinaus braucht es ein elektronisches Monitoring und ein Alarmsystem mit Fussfesseln für Täter wie in Madrid. Derzeit laufen in mehreren Kantonen Versuche dazu.
Spanien hat für den Aufbau dieses Systems allerdings Milliardenbeträge eingesetzt.
Ich bin überzeugt, dass die Kantone bereit sind, Mittel zur Verfügung zu stellen. Auch der Bund will die Sicherheit stärken, nicht nur die Armee, um unsere Bevölkerung zu schützen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Folgen von häuslicher Gewalt auch Kosten verursachen, bei der Versorgung der Opfer oder wenn diese arbeitsunfähig werden.
Bundesrat Jans gibt auch dieses Interview im Flugzeug. Diesmal auf dem Weg von Madrid nach Bern am Dienstagabend. Als durch die Fenster schon die Alpen in Sicht kommen, wird das Gespräch persönlich. Und die politischen Fragen werden plötzlich sehr greifbar, konkret.
Mit den Massnahmen, die Sie schildern, bekämpft man die Folgen des Problems, man bekämpft damit aber nicht die von manchen Männern ausgehende Gewalt.
Beat Jans: Ja, deshalb müssen wir das Problem gesamtgesellschaftlich angehen. Gerade die Männer stehen sehr stark in der Verantwortung. Alle Männer, die merken, dass ein Kollege übergriffig wird, vielleicht sogar seine Partnerin schlägt, müssen handeln, einschreiten und Hilfe holen. Wer schweigt, trägt zum Problem bei.
Ich bin, wie Sie, Vater von zwei Töchtern. Ihre beiden sind 17 und 19 Jahre alt. Wie sehr hat Sie die Thematik der Gewalt gegen Frauen in der Erziehung beschäftigt?
Die Diskussionen mit meinen Töchtern haben mich geprägt. Auch meine Frau hat stets gesagt, der erste Schritt zur Freiheit der Frauen ist die wirtschaftliche, materielle Unabhängigkeit – das war ein roter Faden in unserer Erziehung. Und wir haben ihnen mitgegeben, dass sie sich wehren, wenn sie belästigt werden. Dass sie laut werden im Tram, wenn ein Typ sie betatscht.
Doch so liegt der Handlungsdruck wieder bei den Frauen.
Schon – aber das mussten wir unseren Töchtern sagen. Sich nicht wehren, geht ja nicht. Doch es ist in der Tat höchste Zeit: Wir Männer müssen endlich aufhören zu denken, häusliche Gewalt sei ein Frauenproblem!
Weitere Infos
Dossier
Lotta alla violenza domestica e sessuale
Medienmitteilungen
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Reden
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Interviews
-
«Ich verstehe, dass die Leute besorgt sind»Intervista, 5 settembre 2025: Schweizer Illustrierte
-
«Zuwanderung gehört zur Identität der Städte»Intervista, 29 agosto 2025: Bajour, Hauptstadt e Tsüri
-
Gewalt gegen Frauen: Bundersat Jans sagt Femiziden den Kampf anIntervista, 6 luglio 2025: CH-Media
-
Face aux féminicides, Beat Jans envisage le bracelet électroniqueIntervista, 9 maggio 2025: Tribune de Genève, 24 Heures
-
Bundesrat Beat Jans über Migration, Kriminalität und ZusammenhaltIntervista, 18 aprile 2024: SRF, Gredig direkt
Ultima modifica 29.08.2025